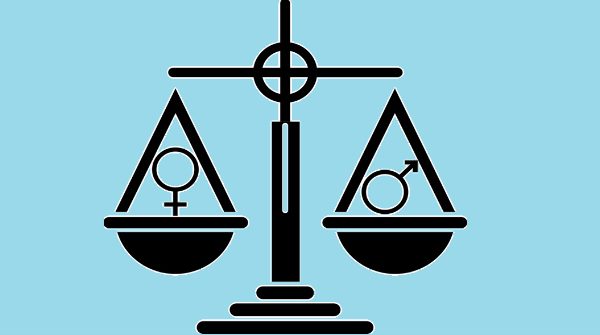E-Sports, so heißen online ausgetragenen Wettkämpfe durch Computerspiele. Die Szene wächst und wächst – und indet außerhalb kaum Beachtung. Blick auf eine Gegenkultur
Von Theo Starck
Wenn man Christoph dabei beobachtet, wie er sich kurz hinter einem Treppenabsatz duckt und eine Granate in eine gegnerische Bunkeranlagen wirft, haben seine ruhigen aber hochkonzentrierten Gesichtszüge so gar nichts mit denen eines ausgebildeten Soldaten gemein. Christoph ist Gamer, sein Spiel der Egoshooter Battlefield 3. Noch vor zwei Jahren spielte er mit seinem Team auf Amateurliga-Niveau, als er verschiedene Angebote von Teams aus der deutschen Profiliga bekam, stieg er aus: »In meinem Studium standen Klausuren an, da blieb nicht mehr genügend Raum für Battlefield. Auf diesem Level ist es einfach sehr zeitintensiv«.
Sein Team bestand damals aus ungefähr 15 jungen Männern aus ganz Deutschland, die meisten hatten sich online kennen gelernt. Von Montag bis Donnerstag trainierten sie drei bis vier Stunden täglich, gingen Strategien durch und stellten diese dann gegen andere Teams auf die Probe. Sonntags fanden die Ligaspiele statt.
League of Legends hat 27 Millionen Spieler – jeden Tag
Das weltweit beliebteste MOBA heißt League of Legends (LoL). Innerhalb von zwei Jahren hat sich die Anzahl der bei LoL eingeloggten Spieler mehr als verdoppelt: 2012 spielten noch zwölf Millionen das Spiel, Anfang 2014 waren es bereits 27 Millionen aktive Gamer – und das jeden Tag. 624 Millionen US-Dollar spielten die Gamer von League of Legends im letzten Jahr in die Kassen der Entwickler. Damit ist das Spiel nach dem Südkoreanischen Egoshooter Cross- Fire, der 2013 sogar 957 Millionen US-Dollar erwirtschaftete, das finanziell erfolgreichste Onlinegame auf dem Markt.
E-Sports nennt sich das Genre der virtuell ausgetragenen Wettkämpfe. Mittlerweile gibt es viele verschiedene Arten von Spielen; von klassischen Sportsimulationen wie der FIFAReihe über die berüchtigten Egoshooter wie Counter-Strike bis hin zu populären Strategiespielen. Viele davon sind in einem Ligasystem organisiert. Besonders großen Spielerzuwachs verzeichneten in den letzten Jahren sogenannte Multiplayer Online Battle Arenas (MOBA). Das grundlegende Prinzip dieser Gattung ist immer gleich: Pro Runde treten mindestens zwei Spieler auf einer virtuellen Karte alleine oder im Team gegeneinander an. Ziel ist es, die am jeweils anderen Ende des Spielfelds gelegene Basis des Gegners zu zerstören. Dabei kann man während des Spiels auf verschiedenen Wegen Erfahrungspunkte sammeln und so die eigenen Figuren verbessern. Wie bei den meisten Onlinegames ist das interessante Moment dabei, dass man gegen reale Spieler antritt, die ihrerseits irgendwo auf der Welt vor dem Rechner sitzen.

Wie auch bei anderen Spielen mit einer Online- Liga beginnt man als Einsteiger mit den für jedermann zugänglichen Ladder-Games. Mit einer zunehmenden Professionalisierung steigen die Gamer dann über die Amateurliga bis in die Profiklasse auf. Die berühmteste deutsche Profiliga ist die ESL Pro Series. Daneben gibt es aber auch andere, vor allem internationale Ligen und Wettkämpfe, von denen die wichtigsten sogar live und in extra für die Begegnungen bereit gestellten Stadien ausgetragen werden. Zu den alljährlich stattfindenden Weltmeisterschaften von League of Legends fanden zuletzt 8.000 Zuschauer den Weg nach Los Angeles. Hinzu kamen über acht Millionen Zuschauer, die das Geschehen vor dem Fernseher oder über stream verfolgten. Preisgeld für das Turnier: über zwei Millionen USDollar.
Längst sind solche Turniere ähnlich wie beim Fußball mit einem riesigen Marketingapparat verknüpft. Firmen wie LG oder Samsung finanzieren ihre eigenen Teams, sponsern ihnen neben der neuesten Hardware und bis zu sechsstelligen Gehältern auch ganze Häuser, in denen das Team zusammen wohnt, kocht und – trainiert. Solche Gaming-Häuser finden sich vor allem in Südkorea, dem unangefochtenen Zentrum des globalen E-Sports.
Dies alles mag für manche wenig überraschend erscheinen, für andere wiederum völlig neu und fremdartig. Aus diesem Gegensatz wird eine eigentümliche Besonderheit der Onlinegames deutlich: Obwohl die Szene selbst immer stärkeren Zulauf bekommt, findet diese Entwicklung außerhalb des konventionellen Interesses der meisten Menschen statt. Diese Erfahrung hat auch Christoph gemacht: »Eine Anerkennung außerhalb der Szene existiert praktisch nicht. Wenn du Außenstehenden erzählst, wie lange du vor dem Computer trainierst, erntest du meistens nur Unverständnis«. Gaming ist für viele noch immer ein Randphänomen, dem Klischee des blassen und zurückgezogen lebenden Computernerds ist nur schwer beizukommen. Die in der Szene verhassten Reportagen einschlägiger Boulevardmagazine tun das Ihrige, um solche Vorurteile weiter zu bestärken. Auch wenn man E-Sport im Duden nachschlägt, sucht man vergeblich. Dass viele der Spiele (noch) nicht massentauglich sind, liegt aber auch an der Kultur selbst, denn nicht eingeweihten Zuschauern ist das Geschehen auf dem Bildschirm, vor allem aber der Jargon der Gamer, schlichtweg unverständlich. Sowohl die Spieler untereinander als auch die Kommentatoren bedienen sich dieser hochgradig codierten Sprache, bestehend aus Abkürzungen, Anglizismen und Insidern, um sich während einer Partie möglichst schnell, effizient und deutlich zu verständigen.
Werden E-Sports einmal olympisch?
Seit einiger Zeit kämpfen die E-Sports auch um eine offizielle Anerkennung, als reguläre Sportart nämlich. Natürlich wird Sport immer zuerst mit einer körperlichen Betätigung assoziiert. Wer Sport treibt, bleibt fit und gesund. In dieses Bild will die Vorstellung des virtuellen Sonderlings so gar nicht passen. Auch Sportverbände wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) erkennen E-Sports nicht als Sportart an, da als Voraussetzung die »eigenmotorische Aktivität« einer Sportart nicht erfüllt sei. Darüber lässt sich natürlich streiten, da sich die motorischen Aktivitäten bei anerkannten Sportarten wie dem sogar olympischen Sportschießen scheinbar nicht all zu sehr von denen des Fingertippens auf der Maus unterscheiden. Auch hier kommt es nicht auf körperliche Stärke oder Ausdauer an, sondern vielmehr auf Präzision – genau wie beim Gaming.
Neben einer ausgeklügelten Strategie sind eine hohe Geschwindigkeit auf der Tastatur und Durchhaltevermögen für einen Pro-Gamer unabdingbar. Die besten Gamer sollen eine bessere Hand-Augen-Koordination als Kampfpiloten haben. Übrigens bekam Schach die Anerkennung als offizielle Sportart schon vor langer Zeit. Eine Ausweitung des Sportbegriffs hat damit längst stattgefunden. Allzu abwegig erscheint die Einstufung von E-Sport als Sportart, so wie in einigen anderen Ländern bereits geschehen, also nicht.
Zocken für die Forschung
Besondere Brisanz erfuhr die Debatte, als der kanadische LoL-Profi Danny Le als erster ESportler überhaupt ein Sport-Visum für die USA bekam. Das P-1A-Visum, das es Sportlern erlaubt, in den Vereinigten Staaten zu leben und mit ihrem Sport Geld zu verdienen, bekamen in der Vergangenheit lediglich »normale« Sportsuperstars wie Dirk Nowitzki. Zumindest auf der Visa-Ebene wurde durch diesen Schritt der E-Sport dem genuin körperlichen Sport gleichgestellt.
Als Medium hat das Computerspiel noch in eine ganz andere Domäne Einzug gehalten: in die Wissenschaft. Gamestudies nennt sich die Forschungsrichtung, die die spezifische Medialität und die neuen Möglichkeiten von Computerspielen untersucht. Dr. Marcel Schellong ist Mitherausgeber von PAIDIA, einer Onlinezeitschrift für Advanced Gamestudies die sich seit einigen Jahren der Erforschung dieses relativ jungen Gebietes widmet: »Gerade hinsichtlich der Erzähl- und Darstellungsmöglichkeiten ist das Computerspiel ein integratives ‚Supermedium‘, das bisherige Formen in sich aufnehmen kann.«
Neben dem sozialwissenschaftlichen Forschungszweig, der auch in den Massenmedien immer wieder auftaucht, hat sich vor allem eine Untersuchung im Kontext der Geistesund Kulturwissenschaften etabliert. »Wenn wir es in den Gamestudies im allgemeinen Verständnis mit digitalen Spielen zu tun haben, geschieht das nicht losgelöst von bisherigen Überlegungen zum Spiel. In diesem Sinne gibt es viele Großväter der Gamestudies, von Schiller über Wittgenstein bis Derrida«, sagt Schellong. Als besonderes narratives Merkmal von Computerspielen gilt das nicht-lineare Erzählen: Anders als bei einem Roman bestimmt nicht der Text, in welche Richtung sich das Geschehen bewegt, sondern der Spieler. Er entscheidet, welchen Weg sein Charakter nehmen soll. Auf solche medialen Eigenheiten reagieren auch die Spiele-Entwickler, weiß Schellong: »Es gibt ausgewiesene Image-Produktionen, die die Qualität des Mediums bewerben und Computerspiele aus der Schmuddelecke holen sollen. Spiele wie Alan Wake oder Heavy Rain erzielen oft keine übermäßig großen wirtschaftlichen Erfolge, bringen aber immer viel positive Präsenz im Feuilleton.«
Gamestudies haben sich als ernst zu nehmende Forschung weitgehend etabliert. Ob es auch der E-Sport aus dieser Schmuddelecke heraus schaffen wird, bleibt abzuwarten. In Südkorea haben Pro-Gamer bereits jetzt den Status von Rockstars erreicht, in Deutschland scheint Ähnliches noch undenkbar. Doch wer weiß schon, ob League of Legends in 20 Jahren nicht bereits olympisch ist. Da wäre es auch egal, ob nun bei den Sommer- oder Winterspielen.