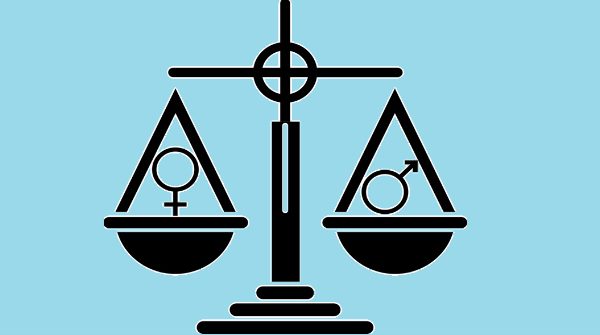Mehr als zwei Jahre lang hat Markus Schäfer in Afghanistan gelebt und gearbeitet. Nicht als Soldat, sondern als Entwicklungshelfer. Ein Interview über die zivile Arbeit in einem Kriegsgebiet.
Das Gespräch führten Jessica Christian und Theo Starck

Wir treffen Markus Schäfer im schönen, doch an diesem Tag etwas verregneten Erfurt. Nach einem kurzen Spaziergang durch das Zentrum der Thüringer Landeshauptstadt suchen wir uns ein nettes Restaurant direkt an der berühmten Krämerbrücke. Derzeit arbeitet Schäfer in einem Bestattungsinstitut, gerade heute habe er Bereitschaft: »Wenn sich also einer aufhängt, muss ich leider schnell los.« Wir hoffen das Beste und beginnen das Gespräch bei Kaffee und Ost-Cola.
Im Jahr 2012 hat Til Schweiger das Bundeswehrcamp in Masar-i-Scharif besucht und den Soldaten im Anschluss zwei Tonnen Nutella aus der Heimat geschickt. Haben Sie während ihrer Zeit in Afghanistan auch einmal Nutella geschenkt bekommen?
(Lacht) Bisher noch nicht. Ich muss allerdings zugeben, es hat schon was, wenn man innerhalb der Bundeswehrstützpunkte in den Geschäften einkaufen kann. Meistens sind es einfach nur Kleinigkeiten, zum Beispiel eine Thüringer Rostbratwurst, die einen aufbauen, wenn man gerade down ist. Wenn man mehrere Monate auf gewisse Dinge verzichten muss, lernt man das Selbstverständliche auf andere Weise wertzuschätzen. Die Versorgungslage in den Camps ist auf jeden Fall nicht schlecht. Es sind andere Sachen, die kritischer zu sehen sind. Etwa die Vorbereitung und Begleitung der Soldaten. Viele kommen in Afghanistan mit falschen Vorstellungen an und haben Schwierigkeiten, mit der Situation vor Ort zurechtzukommen. Ich könnte mir nicht vorstellen, als Soldat nach Afghanistan zu gehen.
Jedes Jahr gibt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, (BMZ) bis zu 240 Millionen Euro für die Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan aus. Ist das einfach zu viel Geld, das dann für sinnlose Projekte ausgegeben wird?
Dem kann ich leider nicht widersprechen. Es gibt genügend Geld. Ich habe viele Projekte geplant, die wir nicht geschafft haben umzusetzen. Das größere Problem ist es, Leute in dieses Land zu bekommen, die die Projekte realisieren. Das ist das Problem, nicht das Geld an sich. Ich bin persönlich sowieso der Meinung, dass viel Geld eher kontraproduktiv ist. Wenn wenig Geld zur Verfügung steht, wird man automatisch Leute haben, die sich bereichern wollen. Wenn man wenig Geld im Projekt hat, ist man auf die Motivation der Leute angewiesen. Kleine Aktionen sind häufig viel effektiver als solche, die eine Millionen Euro gekostet haben.
In welchen Projekten waren Sie in Afghanistan aktiv?
Gleich zu Beginn habe ich in einem Projekt gearbeitet, das mehrere tausend Ex-Soldaten der Nordallianz (Mudschaheddin, Anm. d. Red.) durch Ausbildungen in die Gesellschaft reintegrieren wollte. Dieses Projekt lief über die UN: Ehemalige Soldaten sollten gegen Geldzahlungen ihre Waffen abgeben. Das führte allerdings dazu, dass viele das Geld entweder direkt an Warlords weitergegeben haben oder sich schlichtweg neue Waffen davon kauften. Deshalb ist man dazu übergegangen, den Männern stattdessen eine Ausbildung anzubieten. Neben der schulischen Ausbildung arbeiteten sie als Mechaniker in einer Werkstatt, was glücklicherweise dazu führte, dass viele im Anschluss übernommen wurden.
Sie haben zwei Jahre lang in der afghanischen Hauptstadt Kabul gelebt. Waren Sie nur dort im Einsatz?
Wir hatten landesweit Projekte, unter anderem in Gardez. Das ist ein Gebiet in der Nähe der pakistanischen Grenze, in dem die Taliban sehr aktiv sind. Wir hatten dort eine Berufsschule, die ich – sofern es die Sicherheitslage zuließ – einmal im Monat besucht habe. Die Lehrer, die wir in Kabul ausgebildet haben, wurden dort an die Schule geschickt. Ich fand es immer sehr schade, wenn von deutscher Seite gesagt wurde, dass Projekte nur im Norden durchgeführt werden sollten, wo auch das deutsche Militär präsent ist. Für fremde Organisationen ist es in den südlicheren Regionen meistens sehr schwierig, denn das Misstrauen ist erst mal sehr hoch. Viele denken: Da kommt schon wieder ein Ausländer mit seinen Versprechungen und am Ende hält er sie doch nicht.
Sie waren bereits in Bangladesch und Papua-Neuguinea als Entwicklungshelfer. Hat sich die Arbeit im Afghanistan im Vergleich zu anderen Ländern unterschieden?
Im Vergleich zu Papua-Neuguinea war es in Afghanistan besonders auffällig, dass die Menschen wirklich bereit waren, in den Projekten mitzuarbeiten. Das klingt vielleicht merkwürdig, aber ich finde es dort auch sicherer als in Papua-Neuguinea. Das lag natürlich auch daran, dass ich sehr gut bewacht wurde.
Wurden Sie von den Soldaten der Bundeswehr bewacht?
Nein, das hätte ich auch kategorisch abgelehnt, weil wir dadurch nicht unbedingt sicherer gewesen wären. Ich hatte zweimal die Situation, dass Panzer der Bundeswehr völlig unangemeldet auf das Gelände unserer Berufsschule gefahren sind und von dort aus ihre Operationen durchgeführt haben. Die Schwierigkeit dabei war, dass wir teilweise nicht mehr als zivile, sondern als militärische Organisation mit dementsprechenden Interessen angesehen wurden. Militärische Objekte sind bevorzugte Anschlagsziele, daher sollte man sich nach außen klar positionieren. Ich finde es durchaus sinnvoll, dass die Bundeswehr in Afghanistan die afghanische Polizei und Armee unterstützt, aber wir wurden von privatem, afghanischem Sicherheitspersonal bewacht.
Stehen die militärischen Ziele den zivilen Zielen im Weg?
Das würde ich so nicht sagen. Ich finde, man sollte den militärischen Bereich und den Wiederaufbau getrennt sehen. Ich habe etwa mitbekommen, dass Kollegen vom Technischen Hilfswerk (THW) zwischen zwei Panzern der Bundeswehr gefahren sind mit einem ungepanzerten Fahrzeug. Da fragt man sich: Was soll der Schwachsinn? Als Taliban würde ich natürlich auf das Fahrzeug in der Mitte schießen. Auch die Kollegen vom THW haben sich bei solchen Aktionen unsicher gefühlt. Ich habe es abgelehnt mit dem Militär und der Polizei als Begleitschutz in die Provinz zu fahren. Die Polizei bekommt sehr wenig Geld und die Gefahr, dass man verraten und ausgeliefert wird, ist relativ hoch. Das Risiko wollte ich nicht eingehen.
Waren Sie selber auch einmal in Gefahr?
Ich kann mich daran erinnern, dass einmal ein Panzer der Amerikaner auf ein Taxi auffuhr. Dabei wurden mehrere Menschen getötet. Zwei Stunden später kam mein engster Mitarbeiter völlig zerzaust in unser Büro und meinte, die ganze Stadt wäre in Aufruhr. Ein wütender Demonstrationszug hatte sich gebildet, der zu diesem Zeitpunkt nur noch einen Kilometer von unserer Berufsschule entfernt war. Da unsere Berufsschule auf dem Weg zum Parlament lag, war ich sicher, dass der Zug schon bald bei uns vorbeikommen würde.
Wie reagiert man in solch einer Situation?
Wir haben gesehen, wie die Rauchsäulen immer näher gekommen sind. Von der deutschen Botschaft gibt es in solchen Situationen eine klare Anweisung: Man soll dort bleiben, wo man ist. Ich habe mich dann komplett dagegen entschieden und bin mit einem Tuch über dem Kopf zusammen mit Kollegen in einen Vorort von Kabul gefahren. Dort haben mich afghanische Kollegen in ihrem eigenen Haus versteckt. Wir wussten ja nicht, was diese Proteste auslösen, ob es vielleicht sogar zu einem Umsturz kommt. Dass meine Leute dieses Risiko auf sich genommen haben, hat mir gezeigt, dass ich mich wirklich auf sie verlassen konnte. Tage später habe ich zehn Meter vor meinem Büro Patronenhülsen am Boden gefunden.
Die Bundeswehr hat in Afghanistan jahrelang eine Doppelstrategie mit den Schwerpunkten Sicherheit und Wiederaufbau gefahren. Wie sinnvoll war es, dass auch die Bundeswehr solche zivilen Aufgaben übernommen hat?
Alle Beiträge, die das Land voranbringen, finde ich gut. Wenn ein Militärarzt in ein Krankenhaus geht und dort stundenweise arbeitet, finde ich das eine sinnvolle Sache. Wenn ich aber ein Projekt habe wie die Bundeswehr in einer ländlichen Region bei Kabul, die einen Gesundheitsposten gebaut hat, nur um im Nachhinein festzustellen, dass es kein Personal gibt, das dort arbeiten kann, finde ich das unangemessen.
Sind das nicht normale Probleme, die bei Projekten von NGOs ebenfalls auftreten können?
Das ist vollkommen richtig. Die meisten Entwicklungshilfe-Organisationen machen sich Gedanken, was die Nachhaltigkeit betrifft. Wenn man etwas baut, sollte man sich auch überlegen, was danach passiert. Wenn man in einer Region ein Spital baut, sollte man auch wissen, dass es instandgehalten werden muss und dass man Personal braucht, das auch gut bezahlt werden muss. Sonst wandert es in die Stadt ab.
Haben Sie innerhalb ihrer Projekte mit der Bundeswehr zusammengearbeitet?
Eine inhaltliche Zusammenarbeit kam nicht wirklich zustande. Es gab leider Beispiele, in denen eine Kooperation nicht so funktioniert hat. In Taloqan hatte eine NGO eine Berufsschule gebaut, die direkt gegenüber eines Bundeswehrstützpunktes gelegen war. Auf dem Dach der Schule war eine große deutsche Fahne befestigt, die zeigte, dass das Projekt von Deutschland finanziert wurde. Da hätte ich schon erwartet, dass ein paar der Soldaten rübergehen und bei den Kollegen vom BMZ mal gucken, was dort überhaupt passiert. Aber nein, nichts. Ich war wirklich entsetzt, sie hätten ja nur 20 Meter über die Straße gehen müssen. Wenn man in diesem Land wirklich etwas erreichen will, dann muss man auch raus aus den Camps, man muss mit den Leuten sprechen.
In Afghanistan ist es für Frauen schwierig, einen Job zu bekommen. Dass eine Frau arbeitet, widerspricht den kulturellen Vorstellungen. Wie geht man auf diese Situation vor Ort ein?
Ich hatte diese Situation gerade in der Region von Gardez. Für Projekte, die vom BMZ finanziert werden, gibt es eine Frauenquote. Die liegt bei 30 Prozent. In Gardez ist diese Quote aber nicht einhaltbar. Das würde bedeuten, dass man hier keine Projekte durchführen kann. Aber gerade in dieser Region werden viele Leute von den Taliban rekrutiert. Umso wichtiger ist es, hier Alternativen aufzuzeigen. Was könnte es da Besseres geben als eine Berufsschule?
Sind die Projekte häuig von westlichen Vorstellungen geprägt?
Das ist absolut der Fall. Wenn man Projekte plant, sollte man die Ideen am besten den Leuten vor Ort überlassen und nur unterstützend zur Seite stehen. Sie wissen am besten, was machbar ist und was nicht. Es hängt davon ab, was man für Projekte durchführt. Etwa Schulausbildung für Frauen: Das ist im Norden sinnvoll und machbar. In Kandahar hingegen ist es nicht umsetzbar und nicht kulturell angepasst, dort gibt es an der Universität nicht mal eine Frau. Es braucht alles seine Zeit und man muss vorsichtig rangehen. Von der deutschen Bevölkerung wird zu viel erwartet. Wenn man sich andere Entwicklungsländer anschaut, brauchen sie sehr lange, um gewisse Sachen voranzubringen. Und wir erwarten, dass es von heute auf morgen geht. So ist es leider nicht. Man muss einen langen Atem aufbringen und Schritt für Schritt vorangehen.
Haben Sie das Gefühl, dass es eine positive Tendenz bei der Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan gibt?
Als ich 2009 wiedergekommen bin, habe ich große Veränderungen gesehen. Gerade in Kabul wurde vieles aufgebaut. Die Stromtrasse war fertiggestellt, die Ampeln gingen, nachdem sie jahrzehntelang nicht an waren, Geschäfte waren hell erleuchtet. Die Tatsache, dass Strom vorhanden ist, macht vieles möglich.
Über den Gesprächspartner: Der gebürtige Thüringer Markus Schäfer war von 2005 bis 2007 für eine deutsche Entwicklungshilfeorganisation in Afghanistan. Er arbeitete als Projektleiter und Berater und lebte in der Hauptstadt Kabul. Zu seinen Aufgaben zählten unter anderem die berufliche Ausbildung der dortigen Bevölkerung und die Reintegration afghanischer Flüchtlinge.
Das Interview erschien erstmals im Magazin philtrat.