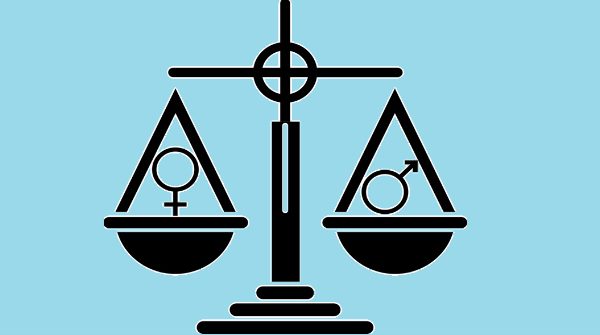Kandinsky, Rilke und Brecht gingen hier ein und aus, Hitler bekam wegen unbezahlter Rechnungen Hausverbot: Um den Schellingsalon in der Maxvorstadt ranken sich zahlreiche Legenden. Was macht diesen Ort so beständig? Ein Gespräch mit der Kellnerin Karin Niantschur.
Das Gespräch führten Bernhard Hiergeist und Theo Starck

An der Ecke Schellingstraße/Barer Straße scheint die Zeit still zu stehen. Einzig die vergilbten Fotografien an den Wänden zeugen davon, dass die Tischdecken früher anders ausgesehen haben. Dasselbe gilt auch für das Personal: Karin Niantschur ist gebürtige Münchnerin und arbeitet seit über 20 Jahren hier. Ob es 23 oder 24 sind – so genau weiß sie das selbst nicht mehr. Es ist offenbar auch egal: Der Salon wird uns sowieso alle überdauern.
Die Wände hier sind voll von alten Fotos und Zeitungsausschnitten. Was muss man denn tun, um an einer der Wände zu landen?
(Lacht) Das sind eben Erinnerungen aus der Zeit. Vorne gibt es zum Beispiel ein Foto, da ist mal ein Auto in unser Fenster rein gefahren. Da war dann erstmal ein Stück Wand weg. Ich glaube aber, das war im Sommer. Da hat das nicht so gestört.
Wie sah es denn früher in der Gegend um die Schellingstraße aus?
Da hat sich einiges verändert. Es gab früher nicht so viele und auch andere Kneipen. Im Barer47 zum Beispiel war früher das Schulz, ein Treffpunkt für Schauspieler und Künstler. Dann gab es die Zeit des Kneipensterbens, als
das Rauchverbot eingeführt wurde. Da haben viele von den alten Lokalen zu gemacht, vorne die Engelsburg zum Beispiel, da ist jetzt das Soda. Das war auch von der Einrichtung her eher so wie der Schellingsalon.
Der Schellingsalon hat das Rauchverbot aber unbeschadet überstanden?
Ja, schon. Wir bieten ja auch Essen an. Die Wirtschaften, die das nicht getan haben, konnten das viel schlechter ausgleichen als die anderen.
Hat sich auch die Kundschaft im Laufe der Jahre verändert?
Selbstverständlich. Ganz am Anfang gab es noch viele Spieler: Schach oder Karten. Das kommt jetzt erst langsam wieder. Das Publikum war insgesamt auch etwas älter und gediegener. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass der alte Wirt, Herr Mehr, oftmals eine Verbindung zu den Leuten gepflegt hat. Dadurch waren manche fast jeden Abend da. Viele von damals kommen heute immer noch her. Bei uns sind bestimmt gut die Hälfte der Gäste Stammkunden – wenn nicht sogar mehr.
Diesen Eindruck bekommt man hier auch von der Belegschaft…
Das stimmt. Alle anderen arbeiten auch schon sehr lange hier, mindestens zehn Jahre. Ich bin über 20 Jahre da und werd‘ auch noch weiter machen, solange ich laufen kann. Studentische Aushilfen gibt es schon auch bei uns, aber das ist eher die Ausnahme. Das Ganze ist also eine sehr eingespielte Sache. Es entsteht dabei auch eine Art von Vertrautheit.
Sie sprechen die Vertrautheit an: Ist denn der Schellingsalon für Sie persönlich auch eine Heimat geworden?
Wenn man viel Zeit an einem Ort verbringt, dann entsteht automatisch eine gewisse Verbundenheit. Sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht immer wieder an diesen Ort zurück gekommen. Von daher ist es schon ein kleines Stück Heimat, ein Zuhause.
Schafft eine alte Institution wie der Schellingsalon nicht auch Vertrautheit für die Gäste?
Das ist vielleicht eine der ganz großen Besonderheiten hier: dass die Leute, die vor dreißig Jahren hier waren, zum Beispiel als Studenten, immer noch kommen. Ganz viele besuchen uns auch, die als Studenten öfter hier waren. Die sagen dann: »Eigentlich hat sich fast nichts verändert.« Die finden alles genauso vertraut wieder, wie sie es noch im Kopf hatten. Viele sind dann ganz froh, wenn sie sehen, dass es uns noch gibt.
Haben Sie da auch ihre persönlichen Lieblinge, über die man sich ganz besonders freut?
Da gibt es schon einige, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manchmal ergibt sich ein Gespräch und dadurch entstehen auch kleine Verbindungen zu den Gästen. Wie bei einem kleinen Spinnennetz, das mit der Zeit immer größer wird.
Heimat ist der Schwerpunkt unserer neuen Ausgabe. Würden Sie zustimmen, dass Sie als Kellnerin an diesem traditionsreichen Ort die wahrscheinlich beste Interviewpartnerin zu diesem Thema sind?
(Lacht) Das fass’ ich jetzt mal als Lob auf, das schmeichelt. Heimat ist ja etwas, womit man sich verbunden fühlt und was es schon lange gibt, was eine Tradition hat. Das trifft also schon zu.
In 20 Jahren Schellingsalon hat man doch sicherlich einiges gesehen.
Sicher, aber das sind keine großen Sachen. Kann sein, dass hier auch mal ein paar Prominente ein- und ausgehen. Oder dass mal Gäste aneinander geraten, aber so etwas kriegen wir immer geregelt. Bei mir bleiben am ehesten so kleine Albernheiten hängen. Einmal ist eine Billardkugel auf die Kreuzung gerollt und der Gast ist hinterher gehopst ist, um sie wieder einzufangen. Passiert ist dabei nichts, lustig war’s aber schon.
Haben die Studenten früher eigentlich mehr getrunken als heutzutage?
Eindeutig ja. Es war früher einfach nicht möglich, ein alkoholfreies Getränk zu trinken, ohne sich in der Öffentlichkeit lächerlich zu machen. Es ging nicht, dass man weggeht und ein Wasser oder eine Spezi trinkt, so etwas war nicht machbar. Deshalb war der Alkoholkonsum insgesamt höher. Dass die Leute deswegen auch betrunkener waren, möchte ich aber gar nicht unbedingt sagen. Auch dass Handwerker morgens kommen und erst mal Brotzeit mit Bier machen, das geht heute überhaupt nicht mehr, war aber früher gang und gäbe.
Geht denn dadurch auch etwas verloren, was zum Beispiel die Gemütlichkeit betrifft?
(Lacht) Nein, da geht nicht wirklich etwas verloren. Ich finde das schon gut so.
Sollten sich die Studenten also generell eher zurücknehmen?
Na, ganz im Gegenteil. Geht’s weiter fuat und freut’s euch am Leben!
Das Interview erschien erstmals im Magazin philtrat.